Die Geschichte der Hexerei

Die Geschichte der Hexerei
Hexerei hat Menschen seit Jahrhunderten fasziniert – mal gefürchtet, mal verehrt. Von den Mythen der Antike über die dunklen Kapitel der Hexenverfolgung bis hin zur modernen Spiritualität: Die Geschichte der Witchcraft ist reich, komplex und voller Magie. In diesem Blogbeitrag nehmen wir dich mit auf eine Reise durch die Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung: Hexerei im Wandel der Zeit
- 2. Hexerei in der Antike
- 3. Hexerei im Mittelalter
- 4. Die Frühe Neuzeit & Hexenprozesse
- 5. Hexerei im 19. & 20. Jahrhundert
- 6. Moderne Hexerei & Spiritualität heute
- 7. Fazit
1. Einführung: Hexerei im Wandel der Zeit
Hexerei – oder englisch Witchcraft – ist kein starres Phänomen, sondern ein kulturelles Spiegelbild dessen, was Gesellschaften über Macht, Körper, Religion, Wissen und Abweichung denken. Mal verehrt als heilsame Kunst der Kräuter, Orakel und Schutzrituale, mal gefürchtet als vermeintliches Bündnis mit dunklen Kräften: Das Bild der „Hexe“ hat sich über Jahrtausende permanent verändert. Wer die Geschichte der Hexerei erzählen will, erzählt immer auch eine Geschichte über Angst und Hoffnung, Kontrolle und Selbstermächtigung, Verfolgung und Befreiung.
1.1 Begriffe, die bewegen – was meinen wir, wenn wir „Hexerei“ sagen?
Unter „Hexerei“ verstehen wir hier nicht eine einheitliche Lehre, sondern ein Spektrum von Praktiken und Glaubensvorstellungen: Volksmagie, Heil- und Kräuterkunde, Wahrsagen, Schutz- und Segensrituale, Ahnen- und Naturkult, bis hin zu kultischen Handlungen, die je nach Region und Epoche sehr unterschiedlich aussahen. Der Begriff „Witchcraft“ wurde oft von außen vergeben – häufig abwertend. Gleichzeitig gibt es Traditionen, in denen Menschen sich den Begriff selbst aneignen und ihn positiv füllen: als Zeichen von Intuition, Naturverbundenheit und spiritueller Eigenmacht.
1.2 Zwischen Alltagspraxis und Projektionsfläche
Hexerei war historisch selten spektakuläre Bühnenmagie – viel häufiger war sie Alltagspraxis: Kräuter gegen Fieber, ein Segensspruch für die Ernte, ein Schutzzeichen über der Tür, ein Traumdeutungsgespräch mit der „weisen Frau“ im Dorf. Zugleich wurde Hexerei zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Spannungen. In Zeiten von Missernte, Krankheit oder politischer Unsicherheit suchte man Schuldige. Das „Hexische“ wanderte dann von den Küchen und Gärten der Heiler:innen in die Anklageschriften von Gerichten – mit fatalen Folgen.
1.3 Macht, Geschlecht und Wissen
Warum wurden so oft Frauen als „Hexen“ markiert? Ein Teil der Antwort liegt in der Schnittmenge aus Care-Arbeit, Körperwissen und sozialer Nähe: Wer Geburten begleitete, Kräuter sammelte, Träume deutete oder Streit schlichtete, verfügte über Einfluss – und damit über ein Potenzial, das patriarchale Ordnungen immer wieder herausforderte. Hexerei erzählt deshalb auch eine Wissensgeschichte: von lokalem, mündlich weitergegebenem Wissen gegenüber institutionalisiertem, männlich dominierten Gelehrtenwissen. Wo diese Wissensformen kollidierten, entstanden Konflikte – und Narrative von „gefährlicher Zauberei“.
1.4 Religion, Recht und Ritual – ein bewegliches Dreieck
Das Verhältnis von Religion, Gesetz und Ritual ist in der Geschichte der Hexerei zentral. In polytheistischen Kulturen wurden magische Praktiken häufig in religiöse Riten integriert. Später verengten monotheistische Systeme den Spielraum: Was nicht in die dogmatische Ordnung passte, galt schnell als „Aberglaube“ oder „Teufelswerk“. Rechtssysteme griffen das auf – mit Edikten, Inquisitionsverfahren und Strafgesetzen. Gleichzeitig blieb die private, familiäre Ritualecke bestehen: Das Salz im Schwellenritual, die Kräuterbündel überm Herd, ein Mondgebet vor der Ernte – vieles lebte trotz Verboten weiter.
1.5 Bilder im Umlauf – von Dämonisierung bis Romantisierung
Die ikonischen Hexenbilder, die wir kennen – vom nächtlichen Flug bis zum Pakt mit Dämonen – sind weniger ethnografische Realität als kulturelle Erzählstrategien. Spätere Epochen romantisierten diese Figuren wieder: Märchen, Theater und Malerei machten die Hexe zur ambivalenten Heldin – gefährlich, frei, naturmächtig. Im 20. Jahrhundert setzte eine zweite Bewegung ein: Spirituelle Szenen und Neuheidentum entdeckten naturreligiöse Praktiken neu; Teile davon begriffen „Witchcraft“ als Weg der Selbstermächtigung und Heilung – ein bewusster Gegenentwurf zu Entfremdung und rein rationaler Weltdeutung.
1.6 Quellenlage: Warum „die“ Geschichte der Hexerei nicht existiert
Wer über Hexerei spricht, arbeitet mit fragmentierten Quellen: Gerichtsprotokolle und Traktate spiegeln die Perspektive der Ankläger, nicht der Angeklagten. Volkskundliche Berichte sind gefiltert durch den Blick von Geistlichen, Beamten oder Forschenden. Und vieles wurde nie schriftlich fixiert, sondern in Familien, Dorfgemeinschaften und Zirkeln mündlich weitergegeben. Das bedeutet: Wir müssen differenzieren, regional denken und Widersprüche aushalten. Eine lineare, homogene „Witchcraft“-Story gibt es nicht – es gibt viele, die sich berühren und widersprechen.
1.7 Warum das Thema heute wieder so relevant ist
Die Rückkehr der Hexerei in Popkultur und spirituelle Praxis fällt nicht zufällig in eine Zeit multipler Krisen. Hexerei bietet eine Sprache für das, was zwischen den Zeilen passiert: Intuition statt Überforderung, Gemeinschaft statt Vereinzelung, Rituale statt bloßem Funktionieren. Für manche ist sie spiritueller Weg, für andere feministische Selbstbehauptung, für wieder andere kulturelles Erbe oder schlicht ein schönes, sinnstiftendes Symbolsystem. Der gemeinsame Nenner: ein bewusster, respektvoller Umgang mit Natur, Körper und Grenzen.
1.8 Wie wir im weiteren Verlauf erzählen
In den nächsten Kapiteln reisen wir von der Antike über Mittelalter und Frühe Neuzeit bis in die Gegenwart. Wir schauen, wie Hexerei in unterschiedlichen Kontexten aussah, warum es zu Verfolgungen kam, welche Rolle Geschlecht, Klasse und Kolonialgeschichte spielten – und wie sich moderne Formen von Witchcraft aus alten Linien speisen und zugleich Neues schaffen. Unser Ziel ist weder Verklärung noch Entzauberung, sondern eine informierte, respektvolle Annäherung an ein Thema, das bis heute berührt.
2. Hexerei in der Antike
Die Wurzeln vieler Hexenvorstellungen liegen tief in der Antike. Schon die frühen Hochkulturen verbanden Magie, Religion und Heilkunst miteinander. Hexerei war hier kein Randphänomen, sondern Teil des Alltags: Priester:innen, Seher:innen und Heiler:innen spielten eine zentrale Rolle in der Verbindung von Menschen, Natur und Göttern. In Mythen, Epen und Schriften begegnen uns Gestalten, die bis heute prägend für das Bild der Hexe geblieben sind.
2.1 Mesopotamien und Ägypten – Zauber als Schutz und Heilung
In Mesopotamien wurden Zauberformeln auf Tontafeln geritzt, Amulette getragen und Rituale durchgeführt, um Schutz vor Dämonen und Krankheiten zu erlangen. Magische Praktiken waren eng mit Religion verwoben und hatten ihren festen Platz im gesellschaftlichen Leben.
Auch im alten Ägypten war Magie (genannt heka) fester Bestandteil von Religion und Medizin. Priester und Magier nutzten Zaubersprüche, Räucherwerk und Symbole, um Heilung, Schutz und Fruchtbarkeit zu sichern. Besonders Frauen im Umfeld von Geburt und Haushalt galten als Hüterinnen dieses Wissens.
2.2 Die griechische Welt – Götter, Mythen und mächtige Frauen
In Griechenland nahm Hexerei oft die Form von Mythen und Erzählungen an. Berühmt ist die Figur der Kirke, die Zauberin aus Homers „Odyssee“. Sie konnte Menschen in Tiere verwandeln, doch sie war nicht nur „gefährlich“, sondern auch weise, mächtig und mit der Natur verbunden.
Auch die Hekate, Göttin der Magie, Wegkreuzungen und der Nacht, war eine ambivalente Gestalt: verehrt als Schutzgöttin, gefürchtet als Herrin über Geister und Zauber. In ihrem Kult verschmelzen Aspekte von Ahnenverehrung, Naturmagie und Schutzritualen.
Griechische Philosoph:innen wie Platon oder Aristoteles diskutierten über Magie zwischen „Aberglauben“ und ernstzunehmendem Wissen. Damit legten sie die Basis für spätere Spannungsfelder zwischen Volksglauben und offizieller Philosophie.
2.3 Rom – Verbot und Faszination
In Rom zeigte sich ein ambivalentes Verhältnis zur Magie. Einerseits war sie allgegenwärtig: Wahrsager:innen, Astrolog:innen und Heiler:innen waren geschätzt, Rituale bei Vollmond und Opfergaben selbstverständlich. Andererseits verboten Gesetze bestimmte Praktiken, besonders wenn sie als Bedrohung für die staatliche Ordnung galten.
Die berühmten Zauberinnen von Rom, wie sie in Dichtung und Theater vorkommen, wurden oft als verführerisch, gefährlich und unberechenbar beschrieben. Hier kristallisiert sich ein Muster, das auch später prägend bleiben sollte: die Projektion von Angst und Begehren auf die Figur der „Hexe“.
2.4 Hexerei als Wissensspeicher
In der Antike wurde magisches Wissen gesammelt, verschriftlicht und weitergegeben. Viele Texte über Heilkräuter, Amulette oder Orakeltechniken überdauerten die Jahrhunderte und flossen in spätere Traditionen ein. So wirkt die antike Hexerei bis heute nach – sei es in Form von Mythen, Symbolen oder Ritualen.
2.5 Übergang zum Mittelalter
Mit dem Aufstieg des Christentums veränderte sich die Wahrnehmung der Hexerei grundlegend. Was in der Antike noch Teil des religiösen und kulturellen Alltags war, wurde zunehmend als „heidnisch“ und „gefährlich“ abgestempelt. Damit begann ein neues Kapitel, das im Mittelalter eine dramatische Zuspitzung erfahren sollte.
3. Hexerei im Mittelalter
Das Mittelalter markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Hexerei. Was in der Antike noch alltägliche Praxis und teilweise verehrte Kunst war, geriet zunehmend in den Schatten der kirchlichen Lehre. Magie, Volksglaube und spirituelle Praktiken verschwanden zwar nie aus dem Leben der Menschen, doch sie standen nun unter wachsender Beobachtung und wurden immer häufiger als Bedrohung für die christliche Ordnung betrachtet.
3.1 Volksglaube und Alltag
Auch im Mittelalter war „Hexerei“ im Kern oft eine praktische, alltägliche Angelegenheit: Kräutermischungen gegen Fieber, Amulette gegen böse Geister, kleine Segenssprüche für Vieh und Ernte. „Weise Frauen“ und „Kräutermänner“ blieben wichtige Anlaufstellen für Heilung und Rat.
Diese Praktiken galten den meisten Dorfgemeinschaften nicht als gefährlich, sondern als notwendig. Wer aber soziale Normen überschritt oder in den Verdacht geriet, Schadenzauber zu betreiben, konnte schnell ins Abseits geraten.
3.2 Kirche und Häresie
Die christliche Kirche sah magische Praktiken zunehmend als Konkurrenz zu ihrer eigenen Deutungshoheit. Gebete, Sakramente und kirchliche Rituale sollten alleinige Mittel sein, um mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten. Alles, was davon abwich, wurde zunächst als „Aberglaube“ abgewertet, später sogar als Ketzerei gebrandmarkt.
Dennoch war die Haltung nicht einheitlich: Manche kirchlichen Gelehrten hielten Hexerei für bloße Illusionen, Täuschungen des Teufels oder Einbildung. Andere wiederum sahen in ihr eine reale, gefährliche Kraft, die bekämpft werden müsse.
3.3 Entstehung des Hexenbildes
Im Laufe des Mittelalters verdichteten sich verschiedene Erzählungen und Ängste zum Bild der „Hexe“: eine meist weibliche Gestalt, die nachts umherfliegt, mit Dämonen paktiert und Schaden über Menschen und Felder bringt. Viele dieser Vorstellungen entstammen nicht der Realität ländlicher Praktiken, sondern sind Projektionen kollektiver Ängste.
So verbanden sich alte heidnische Elemente (wie der Glaube an nächtliche Geisterzüge) mit christlicher Dämonologie. Aus der „weisen Frau“ konnte so in der Vorstellung der „bösen Nachbarin“ oder „dämonischen Hexe“ werden.
3.4 Erste Hexenprozesse
Bereits im Hochmittelalter kam es zu ersten dokumentierten Prozessen gegen angebliche Hexen oder Zauberer. Doch sie waren zunächst regional begrenzt und oft eng mit politischen oder sozialen Konflikten verknüpft. Häufig spielte Neid, Besitzstreit oder ein persönlicher Konflikt die größere Rolle als tatsächliche magische Praktiken.
Erst in der Spätphase des Mittelalters sollten diese Prozesse massiv zunehmen und in regelrechte Verfolgungswellen münden.
3.5 Ambivalenz: Verbot und Faszination
Trotz aller Verbote blieb die Faszination für Magie groß. Adlige ließen sich von Astrologen beraten, Klöster bewahrten geheime Heilkräuter-Rezepte, und selbst in kirchlichen Schriften finden sich Hinweise auf Rituale, die eindeutig aus dem Volksglauben stammen. Diese Ambivalenz prägte das gesamte Mittelalter: Hexerei war offiziell verurteilt, aber inoffiziell lebte sie in unterschiedlichsten Formen weiter.
3.6 Ausblick auf die Frühe Neuzeit
Das Mittelalter bereitete den Boden für die späteren Hexenverfolgungen. Die Kombination aus religiöser Kontrolle, wachsender Angst vor Häresie und sozialen Spannungen führte dazu, dass die Figur der „Hexe“ im 15. und 16. Jahrhundert zu einer regelrechten Obsession wurde. Mit der Frühen Neuzeit beginnt eine Epoche, in der Hexenjagden und Prozesse ungeahnte Dimensionen erreichten.
4. Hexerei in der Frühen Neuzeit
Die Frühe Neuzeit, also grob der Zeitraum vom 15. bis ins 17. Jahrhundert, gilt als die dunkelste Phase in der Geschichte der Hexerei. In dieser Epoche erreichten Hexenverfolgungen ihren Höhepunkt: Zehntausende Menschen, überwiegend Frauen, wurden angeklagt, gefoltert und hingerichtet. Die Angst vor Hexerei war allgegenwärtig – genährt von religiösem Fanatismus, politischer Unsicherheit und gesellschaftlichen Spannungen.
4.1 Der „Hexenhammer“ – ein folgenschweres Buch
Einen entscheidenden Einfluss hatte das Werk Malleus Maleficarum, auf Deutsch „Der Hexenhammer“. Dieses 1487 veröffentlichte Buch von Heinrich Kramer versuchte, Hexerei systematisch als dämonisches Verbrechen darzustellen und legte zugleich Methoden zur „Aufdeckung“ von Hexen fest.
Obwohl das Werk von vielen Zeitgenossen auch kritisiert wurde, verbreitete es sich rasch und prägte die Vorstellung von Hexerei über Jahrhunderte. Besonders fatal: Es stellte Frauen explizit in den Mittelpunkt der Verdächtigungen, was maßgeblich zur Frauenfeindlichkeit der Hexenverfolgungen beitrug.
4.2 Hexenjagden und Prozesse
Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert fanden in Europa unzählige Hexenprozesse statt. Ganze Dorfgemeinschaften wurden von Wellen der Angst erfasst, in denen Nachbar:innen, Verwandte oder Außenseiter:innen denunziert wurden. Unter der Folter „gestanden“ viele Angeklagte Dinge, die sie nie getan hatten – vom Pakt mit dem Teufel bis hin zum nächtlichen Hexensabbat.
Die Verfahren waren grausam: Prügel, Streckbank, Wasserprobe oder andere Methoden sollten angebliche Hexen überführen. Die meisten endeten mit der Hinrichtung durch Feuer oder Schwert. Regionen wie Süddeutschland, die Schweiz und Teile Frankreichs waren besonders stark betroffen.
4.3 Ursachen für die Verfolgungen
Warum gerade in dieser Zeit die Hexenjagden solche Ausmaße annahmen, hat viele Gründe. Die Reformation und Gegenreformation führten zu religiösen Konflikten, Kriege und Hungersnöte verstärkten die Unsicherheit. In Zeiten von Not suchten Menschen nach Schuldigen – und die Vorstellung von Hexen bot eine einfache Erklärung für Unglück, Missernten und Krankheit.
Hinzu kam eine patriarchale Gesellschaftsordnung, die unabhängige Frauen, Heilerinnen und Außenseiterinnen besonders verdächtig erscheinen ließ. So wurden soziale Spannungen und Misstrauen in dramatischer Weise auf dem Rücken vermeintlicher „Hexen“ ausgetragen.
4.4 Hexensabbate und Teufelspakte
In den Schriften dieser Zeit nahm die Fantasie über angebliche Hexenrituale groteske Züge an: Erzählungen von nächtlichen Flügen, Orgien mit Dämonen oder der Anbetung des Teufels machten die Runde. Solche Beschreibungen sagen weniger über die Realität ländlicher Praktiken aus, sondern vielmehr über die Ängste und Projektionen der damaligen Gesellschaft.
4.5 Erste Zweifel und Kritik
Doch schon in der Frühen Neuzeit gab es Stimmen der Vernunft. Gelehrte, Juristen und auch einzelne Geistliche stellten die Praxis der Hexenprozesse infrage. Manche sahen in den Geständnissen bloße Folterfantasien, andere kritisierten die Unmenschlichkeit der Verfahren. Diese frühen Skeptiker legten den Grundstein für das spätere Ende der Hexenjagden.
4.6 Übergang in die Aufklärung
Mit dem 18. Jahrhundert setzte sich zunehmend eine rationalere Weltsicht durch. Wissenschaft, Philosophie und Aufklärung rückten den Glauben an Hexerei in den Bereich des Aberglaubens. Die großen Verfolgungswellen ebbten ab, auch wenn der Glaube an Magie und Hexerei im Volksglauben fortbestand.
So endet die Frühe Neuzeit mit einem zwiespältigen Erbe: Auf der einen Seite unvorstellbares Leid, auf der anderen Seite der Beginn eines kritischen Denkens, das den Hexenwahn schließlich zurückdrängte.
5. Hexerei in der Neuzeit (18.–19. Jahrhundert)
Nach den grausamen Verfolgungswellen der Frühen Neuzeit wandelte sich das Bild der Hexerei im 18. und 19. Jahrhundert grundlegend. Mit dem Zeitalter der Aufklärung schwand der Glaube an Teufelspakte und dämonische Hexensabbate. Doch Hexerei verschwand nicht – sie nahm nur neue Formen an. Statt Angst und Verfolgung traten nun Romantik, Volksglaube und eine neue Sehnsucht nach Magie in den Vordergrund.
5.1 Hexerei als „Aberglaube“
Im 18. Jahrhundert setzte sich in den gebildeten Schichten die Überzeugung durch, dass Hexerei lediglich Aberglaube sei. Wissenschaft und Philosophie dominierten zunehmend die Deutung der Welt, während kirchliche Dämonologie an Einfluss verlor. Hexenprozesse wurden nach und nach eingestellt – 1782 fand in der Schweiz die letzte Hinrichtung einer angeblichen Hexe in Europa statt.
Dennoch hielten sich im Volksglauben viele Praktiken: Schutzamulette, Bannrituale, Kräuterwissen und Segenssprüche wurden in ländlichen Regionen weiter gepflegt und oft von Generation zu Generation weitergegeben. Die „Hexe“ blieb also im Alltag präsent, auch wenn sie ihren Schrecken verlor.
5.2 Romantik und die Wiederentdeckung des Magischen
Mit der Romantik im 19. Jahrhundert erwachte eine neue Faszination für Mythen, Märchen und Magie. Künstler und Dichter griffen alte Hexengestalten wieder auf – man denke an Goethes „Faust“ mit der berühmten Walpurgisnacht-Szene oder an Märchen der Brüder Grimm. Hexen wurden nun nicht mehr nur als böse, sondern auch als geheimnisvolle und mächtige Frauen dargestellt.
Diese literarische und künstlerische Neubewertung machte die Hexe zu einer ambivalenten Figur: mal Symbol für Gefahr, mal für Freiheit und ungezähmte Naturkraft.
5.3 Okkulte Bewegungen und Esoterik
Parallel dazu entwickelten sich im 19. Jahrhundert erste moderne esoterische Strömungen. Geheimgesellschaften, Spiritisten und Okkultisten griffen auf altes magisches Wissen zurück und verbanden es mit neuen Ideen. Tarotkarten, Astrologie und die Suche nach verborgenen Kräften fanden wachsenden Anklang in den aufstrebenden Großstädten Europas.
In diesem Klima wurde Hexerei zunehmend auch als ein Symbol des Widerstands gegen Rationalismus und Industrialisierung verstanden – als Rückbesinnung auf Natur, Intuition und Geheimnis.
5.4 Die Hexe als feministische Symbolfigur
Im Laufe des 19. Jahrhunderts begann die Hexe auch, eine neue Rolle einzunehmen: Sie wurde zur Projektionsfläche für Frauen, die sich gegen patriarchale Strukturen stellten. Ihre Verfolgung in der Frühen Neuzeit galt nun als Beispiel für unterdrückte Weiblichkeit. Erste feministische Denkerinnen erkannten in der Figur der Hexe ein Symbol weiblicher Selbstbestimmung und spiritueller Stärke.
5.5 Übergang in die Moderne
Am Ende des 19. Jahrhunderts war die „Hexe“ längst nicht verschwunden, sondern vielmehr neu erfunden: Sie lebte weiter in Märchen, Literatur, Volksbräuchen und in aufkommenden esoterischen Bewegungen. Dieses Fundament bereitete den Boden für die moderne Hexenkunst des 20. Jahrhunderts – von Wicca bis hin zu heutigen spirituellen Praktiken, die Hexerei als eine lebendige und empowernde Tradition feiern.
6. Fazit & Hexerei in der Gegenwart
Die Geschichte der Hexerei ist ein Spiegel der Menschheitsgeschichte – von archaischen Ritualen über mittelalterliche Ängste bis hin zur Romantisierung in der Neuzeit. Was einst als Bedrohung galt, wird heute zunehmend als Quelle von Wissen, Spiritualität und Selbstermächtigung verstanden.
In der modernen Zeit erlebt Hexerei eine Renaissance. Bewegungen wie Wicca oder zeitgenössische Hexenzirkel interpretieren alte Traditionen neu und verbinden sie mit Themen wie Naturverbundenheit, Spiritualität und Feminismus. Auch in der Popkultur – von Filmen über Serien bis hin zu Social Media – ist die Hexe präsent und inspiriert viele Menschen dazu, ihre eigene spirituelle Praxis zu entwickeln.
Hexerei heute bedeutet nicht mehr Angst oder Verfolgung, sondern Freiheit, Intuition und Verbindung mit den Kräften der Natur. Wer sich darauf einlässt, begibt sich auf einen Weg, der uraltes Wissen mit modernen Lebensweisen verbindet – eine lebendige Tradition, die auch in unserer Zeit nichts von ihrer Faszination verloren hat.
So schließt sich ein Kreis: Von den Mythen der Antike über die Schrecken der Hexenverfolgungen bis hin zu einem neuen, positiven Verständnis im Hier und Jetzt. Hexerei ist mehr als Geschichte – sie ist ein fortwährender Teil unserer Kultur und unseres spirituellen Lebens.
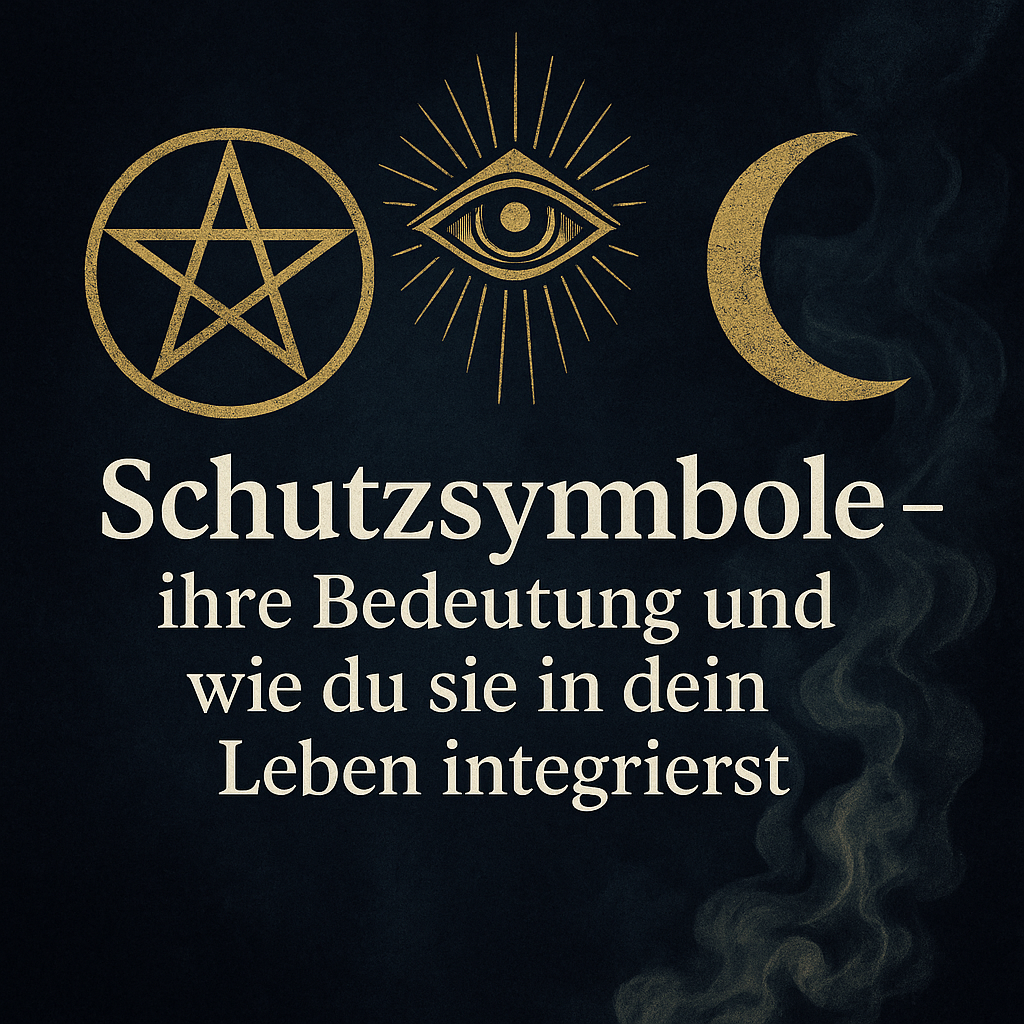

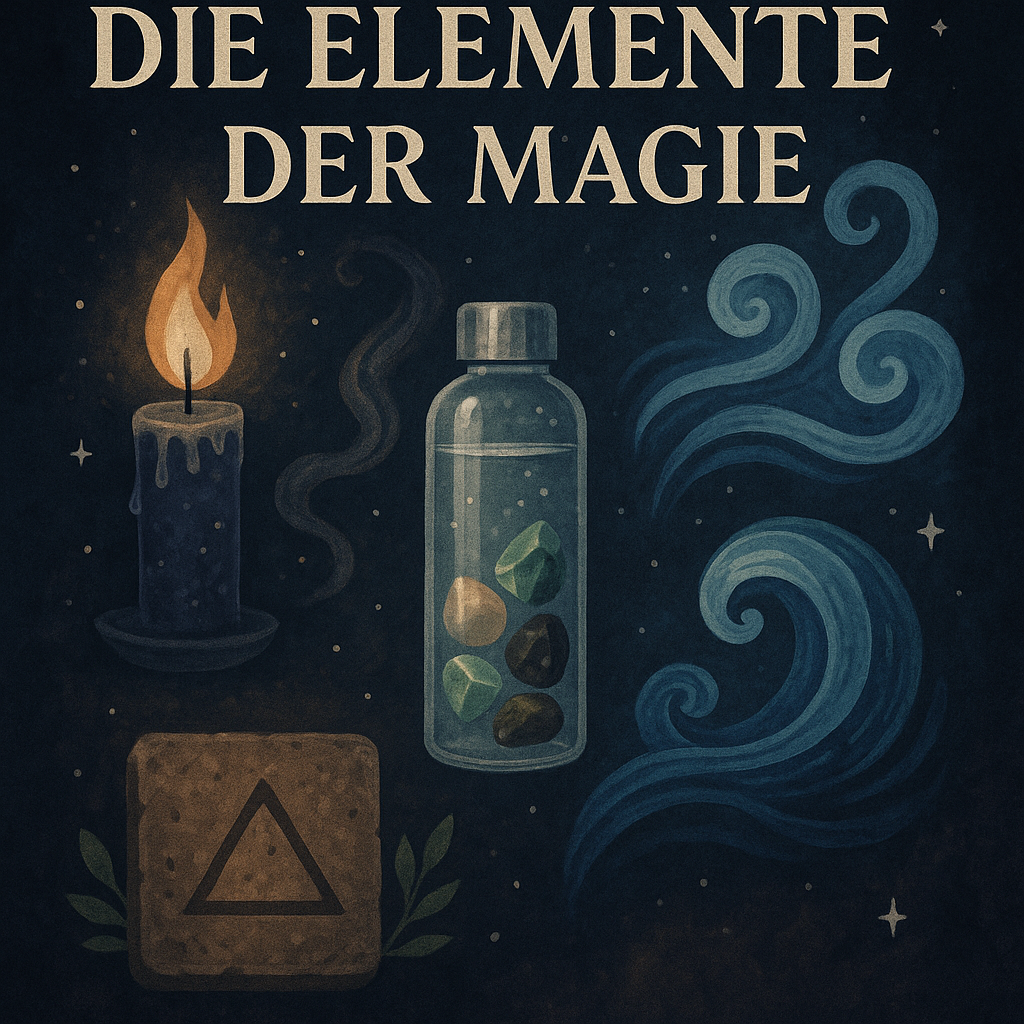


Kommentare